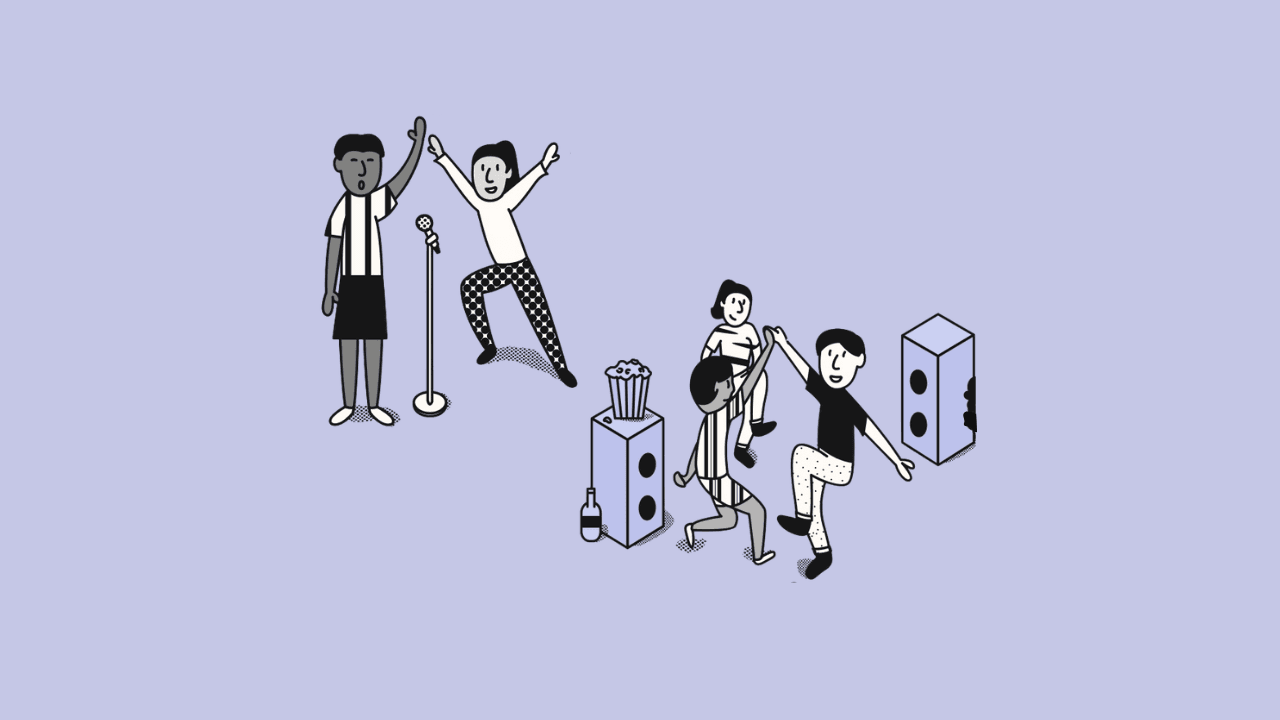© gobasil
Allein oder einsam – eine Begriffsklärung und biblische Aspekte
veröffentlicht 03.06.2025
von Dorothea Eichhorn, Leitung diakonische Sozialarbeit der Diakonie Fürth, Bayern
Anderen Personen nahe zu sein, das Leben miteinander zu teilen und gute Beziehungen zu führen, ist allen Menschen ein natürliches Bedürfnis. Wird dieses Bedürfnis nicht erfüllt, können Einsamkeitsgefühle entstehen.
Begriffsdefinition, Formen und Folgen der Einsamkeit
Begriffsdefinition
Einsamkeit
Das Kompetenznetz Einsamkeit definiert Einsamkeit als subjektiv empfundenen Zustand, bei dem die tatsächlichen sozialen Beziehungen nicht mit den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen übereinstimmen. Dieser Zustand wird von den Betroffenen als schmerzhaft empfunden. Dabei spielt die Qualität von Beziehungen die entscheidende Rolle, mehr als die Quantität. Menschen können sich also auch innerhalb einer Gruppe einsam fühlen.
Alleinsein
Alleinsein ist etwas anderes als Einsamkeit, auch wenn die beiden Begriffe im Alltagssprachgebrauch mitunter synonym verwendet werden, z.B. wenn jemand sich „in die Einsamkeit zurückzieht“, um dem Trubel des Alltags zu entfliehen. Alleinsein ist der sichtbare Zustand, der nicht mit dem schmerzhaften Gefühl von Einsamkeit verbunden sein muss.
Soziale Isolation
Von sozialer Isolation spricht man bei einem objektiv feststellbaren dauerhaften Mangel an sozialen Kontakten und Beziehungen, unabhängig vom subjektiven Erleben. Ausschlaggebend sind Faktoren wie Anzahl der Freund*innen, die Größe des sozialen Netzwerkes und die Häufigkeit sozialer Interaktion. Subjektiv muss sie nicht notgedrungen negativ empfunden werden.
Formen von Einsamkeit
Das Kompetenznetz Einsamkeit unterscheidet zwischen unterschiedlichen Einsamkeitsformen (nach Prof. Dr. Maike Luhmann):
- Als emotionale/intime Einsamkeit wird das Fehlen einer engen, intimen Bindung bzw. einer Person, der man vertraut und von der man als Person bestätigt wird, bezeichnet.
- Von sozialer/relationaler Einsamkeit spricht man, wenn es keine tragfähigen Beziehungen zu Freund*innen oder Familie bzw. kein größeres soziales Netzwerk gibt.
- Kollektive Einsamkeit beschreibt die fehlende Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Gemeinschaft.
- Mit kultureller Einsamkeit ist das Fehlen des bevorzugten kulturellen oder sprachlichen Umfelds gemeint.
Physische Einsamkeit steht für das Fehlen von körperlicher Nähe.
Menschen können von verschiedenen Einsamkeitsformen zugleich betroffen sein oder unter einer Art der Einsamkeit besonders leiden. Ausschlaggebend ist immer das subjektive Empfinden des/der Einzelnen.

© Hasan Sharifi / fundus-medien.de
Wie Einsamkeit entsteht
Meistens wirken verschiedene Faktoren zusammen, wenn Einsamkeitsgefühle entstehen. Die gesellschaftlichen und kulturellen Umstände, die aktuelle Lage und die individuelle Persönlichkeit beeinflussen sich oft gegenseitig.
Lebensereignisse und Umbrüche wie Umzug, Jobverlust oder Verlust einer geliebten Person können jemanden „aus der Bahn werfen“ und zu Einsamkeitsgefühlen führen.
Durch eigene Gedanken und Gefühle wie Schuldgefühle, Hilflosigkeit, das Gefühl, nichts ändern zu können, werden diese mitunter verfestigt.
Dann wird Einsamkeit problematisch
Das Gefühl von Einsamkeit begegnet uns allen im Laufe unseres Lebens. Nach Expert*innen-Meinung ist es für ein gesundes Leben wichtig, Einsamkeitsphasen zu durchleben und zu bewältigen. In der Regel handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Einsamkeitsempfinden. Luhmann unterscheidet in ihrer Expertise Formen unterschiedlicher Zeitdauer. Kurze vorübergehende Einsamkeitsepisoden führen meist zu keiner dauerhaften Beeinträchtigung.
Auch situationsbedingte, durch soziale Umbrüche ausgelöste Einsamkeit, bei der vorher gute soziale Beziehungen existieren, dauern normalerweise nicht an. Voraussetzung dafür ist, dass die Umbruchssituation auf positive Art bewältigt wird.
Die in einem bestimmten Moment empfundene Einsamkeit, z.B. wenn jemand auf einem Fest niemanden kennt, wird in der Forschung als State-Einsamkeit bezeichnet. Sobald der ursächliche Zustand beendet ist, besteht auch das Einsamkeitsgefühl nicht mehr.
Von Trait-Einsamkeit spricht die Forschung, wenn das Einsamkeitsempfinden über eine längere Zeit erlebt wird – unabhängig von der Situation, in der sich jemand befindet. Hält dieses Empfinden dauerhaft (zwei Jahre oder länger) an, verfestigt es sich als chronische Einsamkeit.
Chronische Einsamkeit und ihre Folgen
Chronische Einsamkeit kann zu psychischen Störungen und Erkrankungen wie Schlafstörungen und Depressionen bis hin zu Suizidgefahr führen. Sie erhöht das Risiko für körperliche Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und demenzielle Veränderungen.
Es kommt zu Auffälligkeiten im psychosozialen Bereich, d.h. im Verhalten, Denken und Erleben der Betroffenen, wie z.B. geringeres Vertrauen in andere Menschen und ein geringeres Selbstwertgefühl. Betroffene sind verunsichert und entwickeln Krisenängste.
Das Vertrauen in Mitmenschen, Institutionen und Umwelt sinkt oder geht verloren. Was wiederum abwertende und feindselige Einstellungen nach sich ziehen kann.
Betroffene verlieren das Gefühl von politischer Selbstwirksamkeit. Dadurch kommt es zu verminderter politischer Beteiligung. Die Neigung zum Populismus und zum Glauben an Verschwörungsmythen steigt.
Einsamkeit – eine Gefahr für die Gesundheit
Im Ergebnis mehrerer Einsamkeitsstudien wird immer deutlicher, dass Einsamkeit unsere Gesundheit negativ beeinflussen kann. Friederike Kaiser, Ärztin und evangelische Besuchsdienstmitarbeiterin in Wiesbaden, beschreibt es im aktuellen Besuchsdienstmagazin des Zentrums Seelsorge und Beratung der EKHN wie folgt: „Der Einfluss der Einsamkeit auf Körper und Geist liegt in unserem Gehirn. Reize werden durch Botenstoffe von Nerv zu Nerv übertragen. Je nach chemischer Zusammensetzung werden dadurch auch unsere Gefühle in körperliche Reaktionen übersetzt.“
Einsame Menschen schlafen schlechter, leiden häufiger unter Kopfschmerzen und Verspannungen. Der Blutdruck steigt und erhöht dadurch das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Eine plötzliche Funktionsstörung des Herzens nach körperlicher oder psychischer Stressbelastung wurde mit dem Begriff „broken heart-Syndrom“ sogar bildhaft als Folge des gebrochenen Herzens benannt. Einsamkeit steigert auch das Risiko für eine Alzheimer-Demenz und hat Einfluss auf die Psyche. Angst, Panikattacken und auch Depressionen treten häufiger auf. Durch diese teilweise gravierenden körperlichen Veränderungen ist die Lebenserwartung einsamer Menschen oft niedriger als bei Menschen mit vielen sozialen Kontakten.
Fazit: Einsamkeit macht krank, doch es gibt Wege aus dieser Lage.
Einsamkeit begegnen
Einsamkeit hat viele Gesichter und unterscheidet sich genauso wie die Menschen, die darunter leiden. Daher gibt es auch keine allgemeingültige Lösung, um Einsamkeit entgegenzuwirken.
Das ist eine Gruppe von Menschen, mit denen man durchs Leben geht, Freund*innen, Familie, Partner*innen, Kolleg*innen. Das kann variieren, aber vielen Menschen tut es gut, so einen festen Stamm um sich zu haben.
Wie in vielen Bereichen kommt auch hier der Vorsorge eine große Bedeutung zu. Es gilt, rechtzeitig soziale Beziehungen und ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen. Luhmann spricht vom Konzept des sozialen Konvois:

© Tobias Frick / fundus-medien.de
Biblische Aspekte zu Allein sein und einsam sein
Von Christiane Brendel, Pastorin, Referentin für Besuchsdienst, Service Agentur der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers
Allein sein
Die biblischen Schriften wissen darum, dass das menschliche Leben Zeiten der Gemeinschaft und Zeiten des Alleinseins braucht.
Der Erzvater Abraham steht nachts allein unter dem leuchtenden Sternenzelt, als Gott ihm unzählige Nachkommen verheißt. 1. Mose 15,5
Der junge Mose weidet allein seine Schafe in der Wüste, als der Dornbusch in Flammen steht und Gott ihm persönlich den Auftrag gibt, sein Volk aus Ägypten zu führen. 2. Mose 3,1ff.
Der ältere Mose ist allein, als er die 10 Gebote auf dem Sinai von Gott entgegennimmt. 2. Mose 19,3ff.
Auch der Blick auf die Propheten im Ersten Testament ist aufschlussreich: Gott überwältigt sie mit seiner Gegenwart in dem Augenblick, in dem sie ganz allein sind. Es gibt kein Entweichen für diejenigen, die Gott auswählt, um sein Wort unter die Menschen zu bringen. z. B. Jeremia 1,4-8
Die junge Maria aus Nazareth ist allein, als der Engel Gabriel sie besucht, um ihr zu sagen, dass sie den Heiland Gottes in ihrem Leib beherbergen wird. Lukas 1,26ff.
Die Bibel erzählt in diesen Texten von Menschen, die Gott begegnen, während sie allein sind.
Es gehört zu den spirituellen Übungen aller Religionen, dass Menschen sich regelmäßig eine Zeit des Rückzugs und des (z.T. begleiteten) Alleinseins nehmen, um ihre geistlichen Kraftreserven (wieder) zu entdecken, mit Gott in Beziehung zu treten und ‚neu sortiert‘ in die geschäftige Welt zurückzukommen. Meditationszeiten, Einkehrtage und Exerzitien in katholischen und evangelischen Klöstern bieten solche geistlichen Übungen an.
Wer sich bewusst auf ein solches Alleinsein einlässt, wählt eine andere Ebene der Gemeinschaft. Er oder sie nimmt Gesichter und Worte, Ereignisse und Erfahrungen mit sich in die Stille, lässt Gott und die Welt bei sich ein. Hochgefühle und Glück, Kränkungen und Demütigungen schmecken nach und erhalten ein Gedächtnis in der Seele. Im Alleinsein wachsen innere Bilder, öffnet sich Erkenntnis, ordnet sich die Existenz.
Einsam sein ist etwas anderes als selbst gewähltes Alleinsein
Im Alten und Neuen Testament wird immer wieder erzählt, wie Jesus Menschen aus der Einsamkeit holt.
Mit Rückbezug auf diese Geschichten wird in den Psalmen auf Gottes Treue, seine Begleitung und Gegenwart verwiesen: Selbst an den lebensfeindlichsten Orten, selbst in der größten Einsamkeit war und ist Gott da (Psalm 50,15; Psalm 107).
Jesus auf Golgatha
Jesus zeigt sich als der, der Menschen mit ihren Möglichkeiten und Grenzen erkennt. Er ermutigt sie, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen und hilft ihnen genau dort, wo sie Hilfe brauchen.
Auch Jesus selbst kennt neben der bewusst gewählten Zurückgezogenheit Augenblicke quälender Einsamkeit. Besonders bedrückend ist sie im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wird. Seine Freunde schlafen, während er Gott anfleht, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergehen möge. (Mk 14,32 ff.) In dieser existentiellen Bedrohung seines Lebens erfährt er die schmerzliche Gewissheit, den Weg zum Kreuz gehen zu müssen.
Diese Einsamkeitserfahrung steigert sich noch einmal in seiner Todesstunde am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, schreit er seine ganze Not heraus, hin zu dem Gott, dem er sein Leben lang vertraut hat. In seinem Sterben zeigt sich: Es gibt Augenblicke, in denen Gott nicht mehr spürbar ist. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen bestätigt im Rückblick, dass er auch im Tod nicht gottverlassen war, sondern umgeben von dem Gott, „der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei.“ (Röm 4,17)
Gemeinsam ist all diesen biblischen Zeugnissen die Glaubenserfahrung: Gott kann aus dem Nichts kommen, aus der Todeszone. Er sendet seine Engel zu den Einsamen. Es gibt keinen gottverlassenen Ort auf der Welt.
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“
Matthäus 28,20

© gobasil
Das könnte dich auch interessieren

Arbeitshilfe zum Diakoniesonntag am 21. September: Thema Einsamkeit
Einsamkeit ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem, dem wir als Kirche und Diakonie gemeinsam entgegentreten können. In der Arbeitshilfe zum diesjährigen Diakoniesonntag gibt es viele Anregungen für die Gestaltung von Gottesdiensten und vielleicht auch Inspiration für begleitende Veranstaltungen und Initiativen zum Thema Einsamkeit aus diakonischer Perspektive.