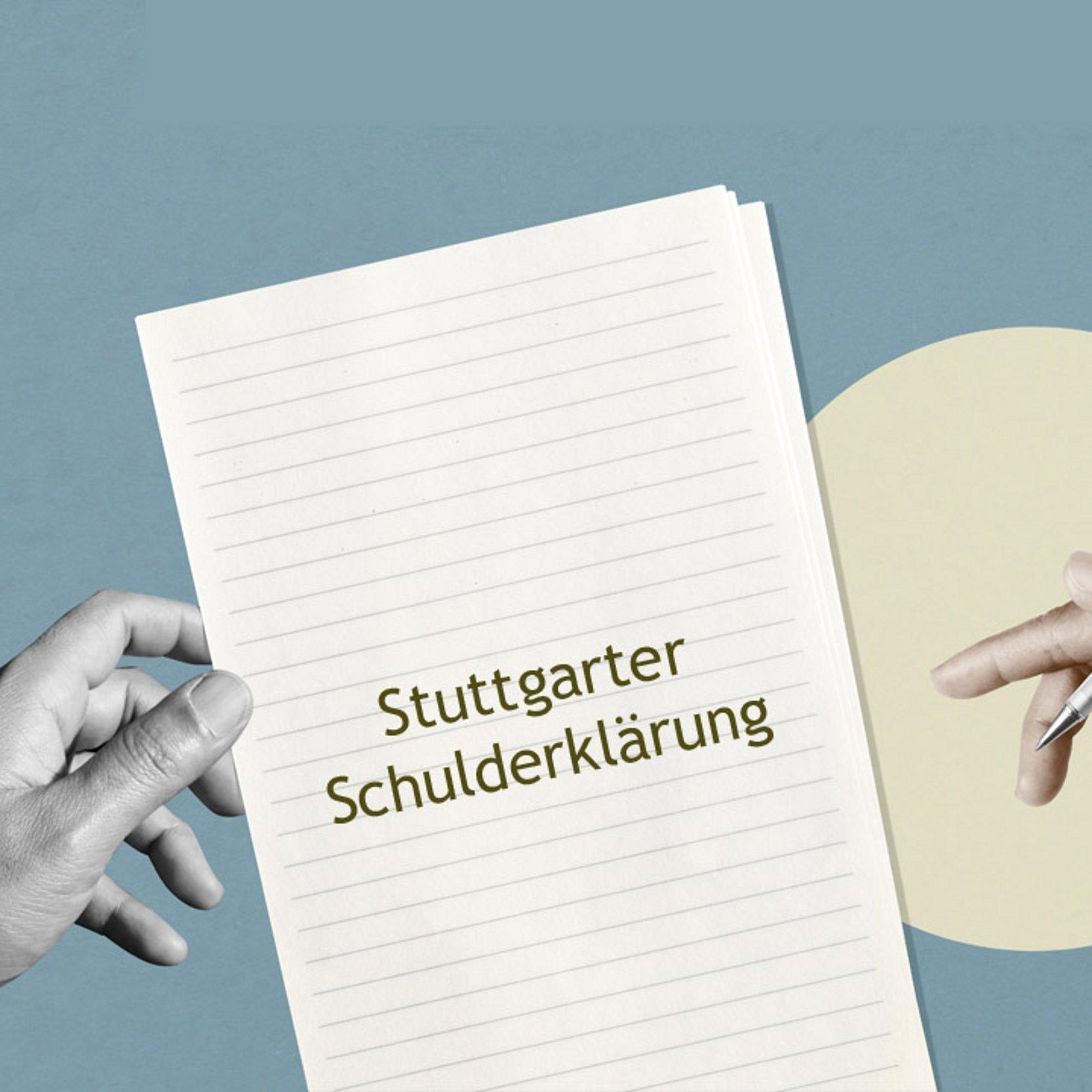
© Getty Images, bombermoon
80 Jahre Stuttgarter Schulderklärung: Mahnung, Mut und blinde Flecken
veröffentlicht 17.10.2025
von Pressestelle der EKD, Online-Redaktion der EKHN
Am 19. Oktober 1945 veröffentlichte der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) die „Stuttgarter Schulderklärung“ – ein historisches Dokument, das den fehlenden Widerstand der Kirche im Nationalsozialismus offen eingestand. Die Erklärung gilt bis heute als Wendepunkt in der kirchlichen Selbstreflexion nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch sie bleibt auch ein Mahnmal für das, was unausgesprochen blieb: das Leid der Opfer der Shoa.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bekannte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in der "Stuttgarter Schulderklärung" den fehlenden Widerstand der Kirche im NS-Staat. Am 19. Oktober 1945 übergab der damalige Ratsvertreter Hans Christian Asmussen das Dokument hochrangigen Kirchenvertretern aus dem Ausland. Mitverfasst wurde die Erklärung unter anderem von Martin Niemöller – Widerstandskämpfer, Mitbegründer der Bekennenden Kirche und späterer Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die Erklärung gilt als mutiger Schritt der Selbstkritik: „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben", heißt es darin. Doch bei aller Klarheit bleibt ein blinder Fleck: Die Shoa – die systematische Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden – bleibt unerwähnt.
EKD-Ratsvorsitzende bezeichnet Schuldbekenntnis als „mutig und lückenhaft zugleich“
Bischöfin Kirsten Fehrs, Vorsitzende des Rates der EKD, würdigt die Erklärung zum 80. Jahrestag als „mutig und lückenhaft zugleich“. Mutig sei der Satz gewesen: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden“. Bischöfin Fehrs erklärt: „Damit hat die Kirche der von Bombenkrieg, Vertreibung und Flucht gezeichneten deutschen Bevölkerung trotz erwartbarer heftiger Reaktionen die Wahrheit über die Kriegsschuldfrage zugemutet.“ Aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar sei aber, dass die Erklärung mit keinem Wort das unermessliche Leid des Holocaust erwähne.
Martin Niemöllers Vermächtnis: Ein Auftrag an die Kirche
Ein Satz, der bis heute nachwirkt, stammt vom Widerstandskämpfer und Ratsmitglied Martin Niemöller: „Nun soll in unserer Kirche ein neuer Anfang gemacht werden.“ Fehrs hebt hervor, dass dieser bewusst im Futur formulierte Satz bis heute zur aktiven Selbstvergewisserung verpflichtet: „Wir haben uns immer wieder neu des entschiedenen Eintretens gegen Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit zu vergewissern.“
Hintergrund: Stuttgarter Schulderklärung
Das Stuttgarter Schuldbekenntnis, offiziell „Schulderklärung der evangelischen Christenheit Deutschlands“ benannt, wurde von den EKD-Ratsmitgliedern Hans Christian Asmussen, Otto Dibelius und Martin Niemöller auf einer Ratstagung in Stuttgart gemeinsam verfasst und dort am 19. Oktober 1945 verlesen. Die Autoren hatten schon in der Bekennenden Kirche während der nationalsozialistischen Herrschaft Leitungsämter bekleidet. Die Erklärung ging aus ihren Einsichten über das Versagen der evangelischen Kirchenleitungen in der Zeit des Nationalsozialismus hervor, die sie im Kirchenkampf und nach Kriegsende gewonnen hatten. Anlass war der Besuch hochrangiger Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), die bereit waren, sich mit den Deutschen zu versöhnen und die EKD aufzunehmen. Dazu erwarteten sie von deren Vertretern ein glaubwürdiges Schuldbekenntnis. Mit der Erklärung kamen die Autoren dieser Erwartung nach und öffneten der EKD den Weg zu ökumenischer Gemeinschaft und verstärkter Hilfe für die notleidenden Deutschen. Eine Auseinandersetzung mit dem Versagen der Kirchen in der Frage des millionenfachen Mordes an Juden fehlt allerdings in dem Stuttgarter Bekenntnis. Es dauerte in den meisten evangelischen Landeskirchen noch bis in die 1980er Jahre, eigene Schuldbekenntnisse und Erklärungen – vor allem im Blick auf die Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden – zu verabschieden.
Das könnte dich auch interessieren

Jubiläum 2026: Hessen feiert 500 Jahre Reformation
Wer heute durch Hessen reist, begegnet einer lebendigen evangelischen Tradition. Doch warum ist das so? Die Antwort führt zurück ins 16. Jahrhundert: zu einem entschlossenen Landgrafen, mutigen Reformatoren und einer Synode, die Geschichte schrieb. 500 Jahre später feiern die Kirchen in Hessen dieses Erbe mit einem Jubiläumsjahr.

27. Januar: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Der Holocaustgedenktag 2026 erinnert daran, dass sowjetische Truppen am 27. Januar das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit haben. An diesem Tag wird der über sechs Millionen ermordete Jüdinnen und Juden, der 500.000 getöteten Sinti und Roma und der vielen anderen Opfer gedacht. Auch jetzt fühlen sich Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder bedroht.
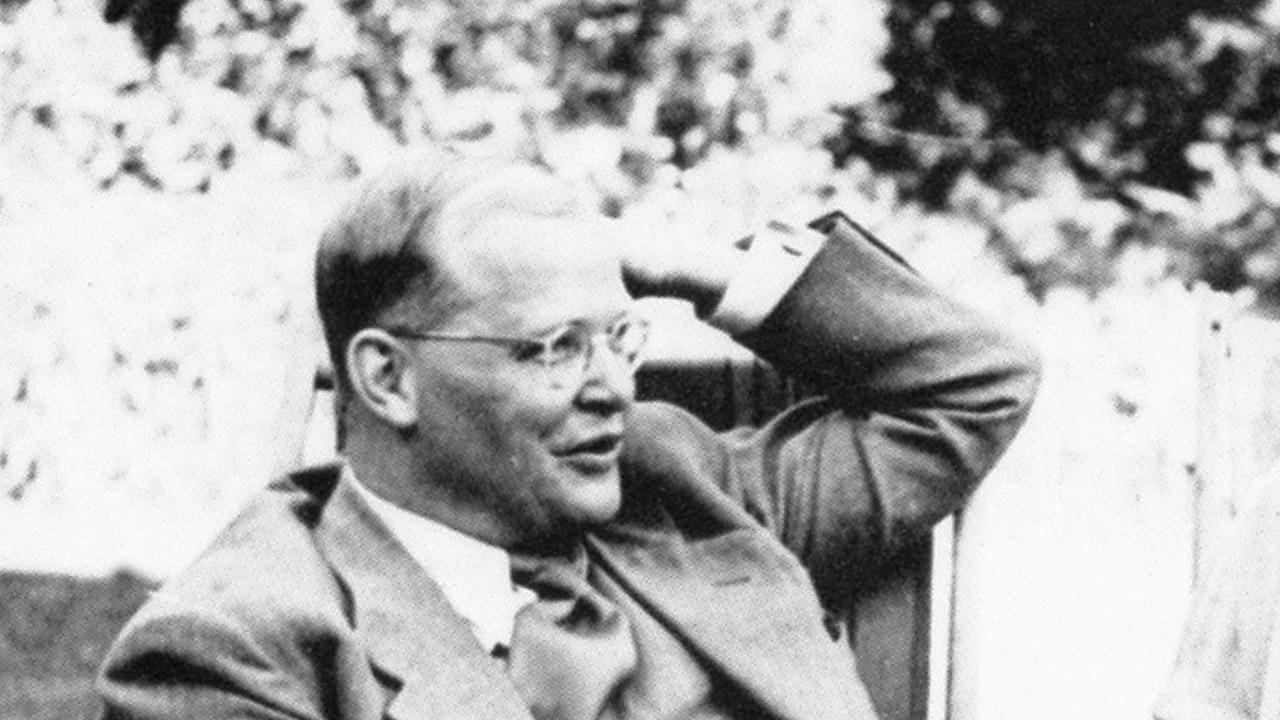
120 Jahre Dietrich Bonhoeffer: Glaube in schwierigen Zeiten
In diesem Jahr wäre Dietrich Bonhoeffer am 4. Februar 120 Jahre alt geworden. Seine Gedanken und sein Leben geben bis heute Halt und Orientierung. Bonhoeffer‑Biografin und EKHN‑Kirchenpräsidentin Christiane Tietz würdigt, dass er sich als „Zeuge des Glaubens“ mutig gegen das NS‑Regime gestellt habe. In Fragen des Glaubens und der Theologie, bei der Suche nach persönlicher Identität sowie für gesellschaftliches und politisches Engagement hat er prägende Impulse gesetzt.
